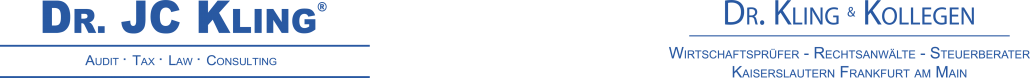Ein Verfahrensbeteiligter, der infolge einer überlangen Dauer eines Gerichtsverfahrens Nachteile erleidet, hat einen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung. In Bezug auf finanzgerichtliche Verfahren hat der Bundesfinanzhof nun erstmals Leitlinien aufgestellt, wann die Dauer eines Verfahrens noch als angemessen anzusehen ist.
Der Wunsch nach einer zügigen Entscheidung ist abzuwägen mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Gerichte und der Tatsache, dass ein fundiertes Urteil in hoher Qualität seine Zeit braucht. Nach dem Gesetz ist für einen Entschädigungsanspruch maßgeblich, ob im konkreten Einzelfall die Bearbeitungsdauer nicht mehr angemessen ist. Insoweit stellt das Gericht folgende Vermutung auf: Ein Gerichtsverfahren besteht in der Regel aus drei Phasen. In der ersten Phase tauschen die Parteien ihre Schriftsätze aus, meist ohne größeres Eingreifen des Gerichts. In der anschließenden Phase ruht das Verfahren, weil das Gericht sich mit anderen Klagen befassen muss. Daran schließt sich die aktive Phase an, in der das Gericht sich wieder dem Streitfall zuwendet und ihn einer Entscheidung zuführt. Die Verfahrensdauer ist in der Regel angemessen, wenn das Gericht mit dieser dritten Phase gut zwei Jahre nach Erhebung der Klage beginnt. Diese so begonnene „aktive Phase“ des gerichtlichen Verfahrens dürfe dann nicht mehr durch nennenswerte Zeiträume unterbrochen werden, in denen das Gericht die Akte unbearbeitet lässt.
Es sind jedoch stets auch die Besonderheiten des Einzelfalles zu berücksichtigen, z.B. Schwierigkeiten rechtlicher Art oder hinsichtlich der Ermittlung des Sachverhaltes.